Mehr Kreativität wagen: Wie die Innovation Factory des Fraunhofer IML den Technologietransfer stimuliert
Manchmal benötigen Innovationen selbst innovative neue Wege, um aus Fraunhofer-Technologie wirkungsvolle neue Anwendungen werden zu lassen. Das Fraunhofer IML hat jetzt eine eigene Innovation Factory gestartet, mit der der Technologietransfer aus Institutsebene weiter angekurbelt werden soll. Wir sprachen mit Benedikt Mättig, Wissenschaftler, Promotor für Technologietransfer und Leiter der Factory, über die Erfahrungen, Lerneffekte und ein unerwartetes Erfolgsgeheimnis des neuen Innovationsformats.
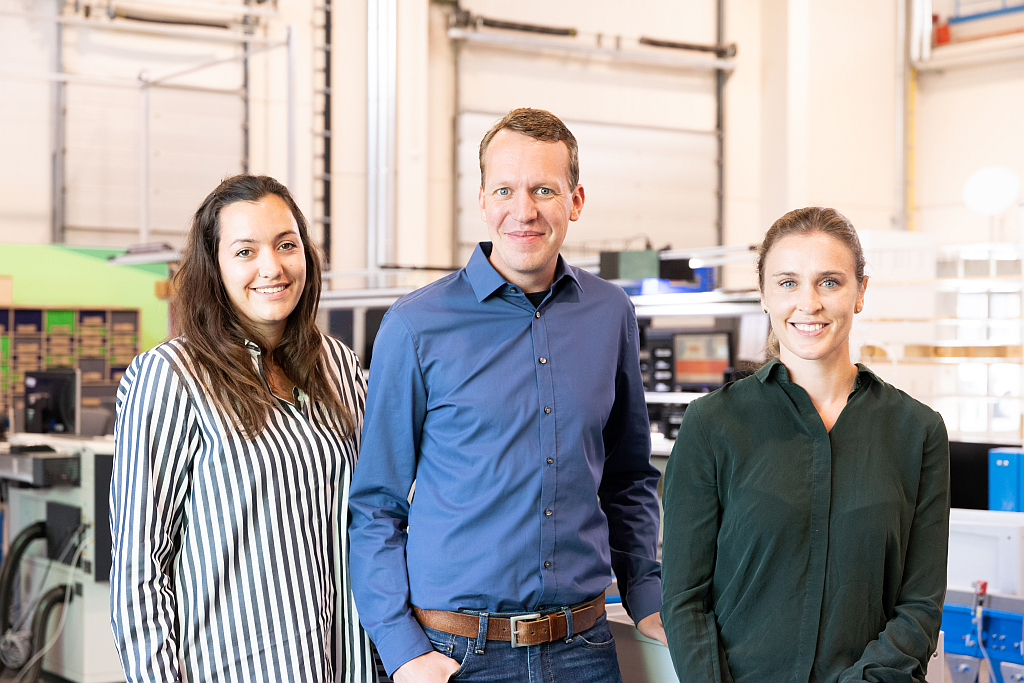
Benedikt, das Fraunhofer IML hat als erstes Institut eine Innovation Factory für den Technologietransfer gegründet. Was verbringt sich hinter dem ambitionierten Namen und wie arbeitet die Innovation Factory?
Die Innnovation Factory ist ein smartes Innovationsprogramm für Wissenschaftler*innen mit Technologien oder Ideen für einen möglichen Tech-Transfer. Die Factory arbeitet dabei wie ein interner Inkubator und bietet den Abteilungen, Teams oder einzelnen Forscher*innen passende Methoden oder Workshop-Formate, mit denen sich Transferpotenziale schnell und unkompliziert identifizieren oder mit Fachleuten entwickeln lassen.
Wenn ein Wissenschaftler oder Abteilungsleiter mit uns Kontakt aufnimmt, analysieren wir zunächst einmal den Reifegrad und Unterstützungsbedarf und erarbeiten dann ein passendes Workshop-Paket und eine Road-Map. In der Kreativitäts- und Ideenphase geht es vor allem darum, mit kreativen Verfahren neue Verwertungsmöglichkeiten zu entdecken, die dann in der zweiten Phase zu einem Konzept entwickelt werden. Wissenschaftler*innen die bereits eine konkrete Blaupause für ein erfolgversprechendes Transferprojekt haben, bieten wir in der dritten Phase Unterstützung bei der Validierung ihres Konzepts, bei der Akquise von Fördermitteln oder Investments oder suchen gemeinsam passende Programme für die Weiterentwicklung zur Marktreife, wie AHEAD beispielsweise.
Warum eine eigene Innovation Factory? Was ist der spezielle Mehrwert für das Institut?
Unseren Forscher*innen haben erstaunlich viele Ideen oder Technologien, die sich für einen Transfer in die Praxis anbieten und professionelle Fördermöglichkeiten für Ausgründungen und Lizenzen gibt es bei Fraunhofer Venture auch genug – aber zwischen diesen Programmen und den Forscher*innen vor Ort klafft eine Lücke, die am Institut geschlossen werden muss. Uns kann man unkompliziert bei einem Kaffee ansprechen und sich erst mal informieren, welche Möglichkeiten man hätte, wie die nächsten Schritte aussähen und wieviel Aufwand dafür nötig ist. Die Factory ist Teil des eigenen Instituts und der unkomplizierte Netzwerker, Türöffner und wenn nötig auch mal der Mediator vor Ort, der dafür sorgt, dass Ideen und Technologien den bestmöglichen Förderweg finden.
Für das Institut schaffen wir damit mittelfristig mehr potenzielle Transferprojekte, mehr IP und mehr Schnittstellen zu Partnern in der Industrie. Gleichzeitig reduziert sich der Aufwand pro Projekt, weil wir institutsintern sehr gezielt und agil arbeiten können. Unser langfristiges Ziel ist aber vermutlich strategisch wichtiger: Wir möchten das Transferdenken und -handeln „normalisieren“, also als Selbstverständlichkeit im Forschungsalltag verankern. Dafür nutzen wir alle gewöhnlichen und ungewöhnlichen Wege, von Info-Lunches über klassische Plakatierungen bis hin zu kleinen kreativen Events, zum Beispiel mit Ex-Kollegen, die heute im eigenen Unternehmen erfolgreich sind.
Was kann die Innovation Factory, was andere Formate nicht können?
Methodisch setzt unsere Factory da an, wo die klassischen Instrumente der Innovations- und Transferförderung heute noch an Grenzen stoßen: Bei der technologiebasierten Ideen- und Konzeptentwicklung, bevor Ausgründungen oder Lizensierungen überhaupt ein Thema werden.
Viele Kollegen stellen sich natürlich auch persönliche Fragen, wenn es um Entscheidungen geht, die für sie selbst richtungsweisend sein könnten. Wir denken vom einzelnen Wissenschaftler und dem Institut her, nicht nur aus der Perspektive der unmittelbaren Verwertung, also quasi bottom-up statt top-down und das kommt gut an. Bislang haben mehr als 50 Wissenschaftler*innen an unseren Workshops teilgenommen und die Motivation, selbst ein Transfer-Projekt zu starten, ist zumindest gefühlt signifikant gestiegen. Um es auf den Punkt zu bringen: Fraunhofer Venture unterstützt Ausgründungen und Lizenzprojekte und wir schaffen mit der Factory die Motivation und die Projekte dazu. Außerdem haben wir in den ersten Monaten der Arbeit der Factory gelernt, dass man in der frühen Transfer-Phase mit Standard-Methoden alleine nicht weit kommt. Hier müssen zunächst einmal viele verschiedene Anwendungsszenarien entwickelt werden, die dann in den Praxistest gehen. Dafür sind kreative Herangehensweisen nötig, die auch nicht zum wissenschaftlichen Standard-Repertoire gehören – aber genau das macht sie für uns so interessant.
Wie nutzt ihr diese strategische Kreativität genau? Wie sieht der „kreative Use-Case“ aus?
Methodisch setzen wir Kreativwerkzeuge ein, um einen Möglichkeitsraum für Technologien zu entwickeln und nach konkreten Anwendungsszenarien zu suchen. Das hilft uns vor allem bei der zentralen Herausforderung einer Gesellschaft in der digitalen Transformation: Der effektiven und humanen Gestaltung von Mensch-Technik-Schnittstellen.
Ein Beispiel: Wir entwickeln hybride Mensch-Maschine-Dienstleistungen für die Logistik der Zukunft mit kreativen Verfahren im kreativen, gesteuerten Dialog mit den Anwendern. Wenn man einem Lagerarbeiter die Interaktion mit einem autonomen Fahrzeug beibringen soll, muss Vertrauen aufgebaut werden. Hier nutzen wir kreative Methoden, um neuartige Lernformate zu entwickeln. Auch in umgekehrter Richtung, wenn Technik den Menschen besser verstehen soll, helfen kreative Methoden, um die Kluft zwischen Mensch und Technik zu überwinden. Man kann beispielsweise maschinengestützt ein viel besseres Verständnis für den Menschen entwickeln, wenn man z.B. Künstliche Intelligenz anwendungsnah einsetzt, um aufwändige Retourenprozesse in der Fashion-Industrie zu vermeiden. Kreativität sowohl im Verfahren wie bei den Anwendungsmöglichkeiten ist in solchen Anwendungsfällen unsere Schlüsselressource. Wir tun uns als Wissenschaftler*innen vielleicht etwas schwer mit einer Ressource, die so schwer greif- und messbar ist, aber erstens rechtfertigt sie der Erfolg und zweitens sind viele Wissenschaftler*innen ausgesprochen kreativ, wenn man sie mit entsprechenden Formaten anleitet und unterstützt.
Was empfiehlst du Wissenschaftler*innen oder Promotoren, die eine ähnliche Herausforderung an ihrem Institut haben?
(Schmunzelt) Sprecht mit uns, wir finden sicher die passende kreative Methode für euer Institut. Im Ernst: Wir haben bei der Gründung selbst viel Unterstützung von Kollegen anderer Institute erhalten und helfen natürlich gerne weiter. Wir haben mit der Factory sicher eine gute Basis geschaffen, aber auch wir lernen ständig weiter und ein kulturveränderndes Instrument muss natürlich genau zu den Gegebenheiten der Institute und Wissenschaftler*innen vor Ort passen.
Benedikt, vielen Dank für deine Zeit und die die kreativen Einblicke in die Innovation Factory.
Weitere Information über das Fraunhofer IML
Du überlegst, selbst auszugründen oder deine Technologie zu lizensieren? Nimm bei unserem Technologietransfer-Programm AHEAD teil oder kontaktiere dein Betreuertandem.
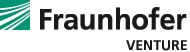 Fraunhofer Venture
Fraunhofer Venture