Die Wissenschaft vom Tech-Transfer
Technologie-basierte Innovationsprogramme müssen in Zeiten der digitalen Transformation Höchstleistungen liefern: Konzepte, Prototypen, Test- und Entwicklungszyklen müssen schneller denn je verwertbare Ergebnisse liefern. Für den Technologietransfer aus der Wissenschaft könnte ein methodisch systematisierter Brückenschlag zu realen Anwendungsszenarien und eine neue Transfer-Kultur die Antwort auf diesen Transformationsdruck sein. Wir sprachen mit Peter Keinz, Professor für Entrepreneurship und Innovation an der Wirtschaftsuniversität Wien und Partner von Fraunhofer Venture über Möglichkeiten den Technologietransfer weiter zu entwickeln.

Peter, du hast in den vergangenen Jahren viele Transfer-Projekte als Coach und Berater begleitet. Wie schätzt du das Marktpotenzial von Technologie aus dem Hause Fraunhofer generell ein?
Sehr hoch. Die Fraunhofer-Institute sind in nahezu allen technologischen Zukunftsfeldern aktiv, nicht selten sogar als technologische Taktgeber. Für mich als Forscher und Coach für Technology Competence Leveraging, grob übersetzt dem systematischen Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Anwendung, gehört Fraunhofer mit dieser enormen Bandbreite an Technologien zu den spannendsten Institutionen für Transfer-Projekte überhaupt. Für nahezu jede Herausforderung aus der Industrie scheint es in diesem Fundus Möglichkeiten für neue technologische Lösungsmöglichkeiten zu geben. Eine besondere Herausforderung bleibt allerdings das Scouting, das Finden vorhandener Technologien und Lösungskompetenzen für bestehende Probleme.
Du hast selbst eine systematische Methode für den Technologietransfer entwickelt und arbeitest damit für mehrere große wissenschaftliche Einrichtungen. Wie wendest du die TCL Methode bei Fraunhofer Venture an und was leistet sie für Wissenschaftler und Institute?
Die TCL-Methode ist eine systematisierte Methode, um durch Analyse, Reflexion, Assoziation und kreatives Denken neue Anwendungsfelder für bestehende Technologien zu finden. Da dieses Matching von Problemen und Lösungsmöglichkeiten zu den absoluten Grundlagen von Ausgründungen oder Lizenzpartnerschaften gehört, setzen wir sie vor allem in der Frühphase der Geschäftsmodellentwicklung ein, beispielsweise im Rahmen des AHEAD-Programms oder anderen Events und Projekten von Fraunhofer Venture.
Mit dieser Methode können wir zusammen mit den Wissenschaftler-Teams zum einen den Horizont an Anwendungsmöglichkeiten vervielfachen und zum anderen einen ersten Proof-of-Concept für die bestehenden Hypothesen zur Anwendbarkeit leisten. Die Teams lernen meistens sehr schnell, dass der Markt wesentlich mehr und meistens bessere Möglichkeiten zur Technologie-Verwertung bietet, als man vorab angenommen hatte.
Darin liegt auch der Vorteil für die Institute als IP-Eigner: Mit einer genauen Analyse der möglichen Anwendungsfelder wächst natürlich auch der Wert der vorhandenen IP. Ich habe den Eindruck, dass wegen des unvollständigen Spektrums an Anwendungsmöglichkeiten IP aus der Forschung häufig drastisch unterbewertet ist. Diese Potenzialanalyse steigert somit auch den Marktwert vorhandener Technologien und Patente und ermöglicht es den Instituten zudem, von der eher reaktiven Technologieverwaltung hin zur proaktiven Technologieverwertung bei den identifizierten Anwendungsmöglichkeiten umzuschalten.
Wie gehst du bei Fraunhofer-Programmen dabei genau vor? Was erleben die Teams mit deiner Methodik?
Wir begleiten die Teams mit Ausgründungs- oder Lizenzprojekten in vier Schritten von der Technologie und Markthypothese bis hin zum Markteintritt mit einem validierten Produkt für reale Anwendungen.
Den ersten Schritt dieses Brückenschlags müssen die Wissenschaftler selbst mit unserer Anleitung tun: Die gewohnte Tech-Perspektive, die „Comfort-Zone“ für Wissenschaftler verlassen und systematisch reale Problemlösungen für bestehende Herausforderungen entwickeln, also die bewährte Sichtweise geradezu umkehren: Wer wirtschaftlich erfolgreich sein will, muss seine Tech-Parameter, Tech-Begriffswelten und Tech-Prioritäten verlassen und das eigene Werk mit den Augen potenzieller Anwender reflektieren können. Dieser erste Kraftakt fällt Vielen nicht leicht, er wirkt aber wie eine Initialzündung: Viele Teams geraten danach in einen regelrechten Flow bei der weiteren Entwicklung.
In einem zweiten Schritt werden weitere Zielgruppen, Märkte und Anwendungsfälle mit kreativen Methoden und Crowdsourcing generiert. So entwickeln wir einen Pool an Anwendungsmöglichkeiten, aus denen ausselektiert werden kann. Nicht selten ändern sich hier die Zielmärkte grundlegend, weil interessantere, bisher nicht bedachte Anwendungsfelder identifiziert werden können.
Anschließend müssen konkurrierende Technologien und Lösungsansätze analysiert und bewertet werden. Nicht immer bringt die technologisch fortschrittlichste Lösung potenziellen Kunden auch die größten Vorteile. In einem vierten Schritt unterstützen wir die Teams beim Markteintritt. Der Fokus unserer Methode liegt allerdings in der frühen Phase der Lösungsentwicklung, wo die Weichen für das spätere Produkt gestellt werden.
Du bist ein Kenner der europäischen Tech- und Forschungsszene. Was können Organisationen und Institute unternehmen, um den Technologie-Transfer zum „Neuen Normal“ werden zu lassen?
Ich finde, Fraunhofer ist da im europäischen Vergleich schon sehr gut aufgestellt und gehört für mich zu den Best Practices in Europa. Betrachtet man jedoch das angesprochene Potenzial an vorhandenen Technologien, dann gibt es noch viele ungehobene Schätze. Das Transfer-Denken als „Neues Normal“ ist noch nicht überall angekommen und auch bei den erfolgreichen Transfer-Pionieren gibt es natürlich noch Verbesserungsmöglichkeiten. In den USA beispielsweise werden die meisten Forschungsprojekte auch im Hinblick auf eine mögliche Kommerzialisierung angelegt. Der mögliche Transfer ist Teil der Wissenschaftskultur und auf allen Hierarchieebenen selbstverständlich, von der Leitung bis zum Kleinprojekt. Incentivierungen, Reputationsgewinn und das Denken als Wissenschaftler und Unternehmer sind Teil dieser sehr anwendungsnahen Forschungskultur. In Europa müssen wir diese Mentalität gerade im kostenintensiven, langwierigen Hightech-Bereich noch weiterentwickeln. Auch die Rahmenumstände wie die eine vereinfachte Verwaltung oder eine gut entwickelte Venture Capital Szene für Deeptech kann sicher noch verbessert werden.
Für die Wissenschaftler selbst kann ich hier nur empfehlen: Probiert euch und eure Technologie aus. Es gibt gerade bei Fraunhofer und Fraunhofer Venture viele unkomplizierte Möglichkeiten, das Marktpotenzial einer Technologie und euer eigenes unternehmerisches Potenzial zu testen und sich selbst das Mindset eines Entrepreneurs anzueignen.
Peter, vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke in die „Wissenschaft des TechTransfers“.
Du möchtest mehr über die TCL-Methode erfahren oder diese gleich bei deiner Idee anwenden? Nimm bei unserem Technologietransfer-Programm AHEAD teil.
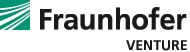 Fraunhofer Venture
Fraunhofer Venture